„Liebe ist nicht nur ein Wort – Liebe, das sind Worte und Taten…“ Dieser Kirchentagsohrwurm wäre vermutlich das Lieblingslied Johann Hinrich Wicherns geworden – wenn er denn noch lebte. Dass die beherzte barmherzige Tat ebenso wichtig für den Glauben – und die Kirche! – ist wie die Verkündigung des Wortes: Darum ging es ihm zeitlebens. Als „Pionier“ und „Kirchenvater der Diakonie“ wird Wichern heute bezeichnet, auch als „Herold der Inneren Mission“ oder „Anwalt der Armen“. Ehrenbezeichnungen, die ins Schwarze treffen. Denn was Wichern Mitte des 19. Jahrhunderts begann, trägt heute überaus reiche Früchte. Die Diakonie ist unverrückbare Säule der evangelischen Kirche.
Wichern hatte starke depressive Phasen
Es ist tragisch, dass Johann Hinrich Wichern am Ende seines Lebens von starken depressiven Phasen heimgesucht wurde, die ihn am Fortbestand seiner Arbeit zweifeln ließen. Seine Lebensgeschichte ist voll persönlicher Dramatik und leidenschaftlichem Engagement, voll wundersamer Erfolge und bitterer Rückschläge.
Johann Hinrich Wicherns Jugendtagebücher gewähren heutigen Leserinnen und Lesern bewegende Einblicke in die Seele des jungen Mannes. Die Eintragungen lassen erahnen, weshalb Glaube und Erziehung zu den Lebensthemen Wicherns wurden. In großer Ehrlichkeit beginnt Wichern als 18-Jähriger, sich Rechenschaft über sein bisheriges Leben abzulegen.
Drei Erfahrungen kristallisieren sich als besonders prägend heraus: Im Alter von sechs Jahren flieht er mit seiner Familie aus dem französisch besetzten Hamburg aufs Land, er erlebt und erleidet Heimatlosigkeit, Not und Elend. Als er 15 Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Wichern ist zu Tode betrübt – und fühlt sich doch endlich befreit zu einem selbstverantworteten Leben und Glauben. Um seine Mutter und Geschwister zu unterstützen, arbeitet er als Erziehungsgehilfe. Hier entdeckt er seine Passion und sein Talent für Pädagogik.
Schleiermachers praktische Theologie beflügelt Wichern
In ihm entsteht der Wunsch, Theologie zu studieren – und den setzt er, gegen Vorbehalte väterlicher Freunde, um. In Göttingen und Berlin lernt er die wissenschaftliche Sicht des Glaubens kennen. Besonders die Ansichten des renommierten Theologen Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher sprechen ihm aus der Seele. Beim Thema Religion gehe es mehr um Gefühl als um dogmatische Lehrsätze, lehrt dieser. Wichern kehrt nach Hamburg zurück und absolviert sein erstes theologisches Examen. Zunächst arbeitet er als Lehrer an einer Sonntagsschule. Kindern aus armen Verhältnissen wird hier Lesen, Schreiben und Glauben beigebracht.
Aber Wichern möchte nicht nur am Pult lehren, sondern Kinder aus ihrem Schicksal erlösen. Also besucht er die Familien zuhause. Was er in den Hamburger Elendsvierteln an Verwahrlosung erlebt, schockiert ihn. Unsägliche hygienische Verhältnisse, Armut, Hunger, Gewalt, Prostitution – Zustände, die in ihm die Idee einer „Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder“ reifen lassen. Schon früh hatte Wichern Bekanntschaft mit Hamburger Honoratioren gemacht. Als ein vermögender Syndikus von der Vision Wicherns erfährt, ist er Feuer und Flamme.
Mit dem “Rauhen Haus” in Hamburg-Horn fängt alles an
Der Mäzen stellt ein Grundstück in Horn, einem Vorort Hamburgs, zur Verfügung, genannt das „Rauhe Haus“. Wichern sammelt Spenden und Unterstützer. Im September 1833 ist es so weit, die Rettungsanstalt „Das Rauhe Haus“ wird gegründet. Acht „Proletarierkinder aus Hamburgs dunkelsten Vierteln“ ziehen ein.
Das Erziehungskonzept Wicherns ist wegweisend bis heute. Kinder werden in familienähnlichen Wohngruppen betreut. Zu ihrer Ausbildung gehören nicht nur die klassischen Schulfächer, sondern auch handwerkliche oder hauswirtschaftliche Fähigkeiten als Vorbereitung fürs Berufsleben. Der Tagesablauf ist fast klösterlich strukturiert durch Andachten, Arbeitszeiten und Ruhephasen. Behutsam führt Wichern die Kinder in die christliche Lebensführung ein.
Oberstes Prinzip ist Freiwilligkeit
An Sonntagen wird nicht gearbeitet. Kirchliche Feste werden kindgemäß und fantasievoll zelebriert. Um die Adventszeit erfahrbar zu machen, ersinnt Wichern einen Adventskranz, an dem jeden Tag eine Kerze mehr entzündet wird. Wichtigster Grundpfeiler von Wicherns Pädagogik ist die Freiwilligkeit.
In einem Aufnahmeritual wird den Kindern verkündet: „Hier ist keine Mauer, kein Graben, kein Riegel; nur mit einer schweren Kette binden wir dich hier, diese heißt Liebe, und ihr Maß ist Geduld. Das bieten wir dir, was wir fordern, ist zugleich das, wozu wir dir verhelfen wollen, nämlich dass du deinen Sinn änderst und fortan dankbare Liebe übest gegen Gott und Menschen!“
Eine bemerkenswert freie Methode in einer Zeit, als andere „Rettungshäuser“ oder „Erziehungsanstalten“ mitunter Gefängnissen ähneln. Das Hamburger „Rauhe Haus“ expandiert. Immer mehr Kinder werden aufgenommen, bald entsteht ein ganzes Dorf.
Einer der bekanntesten Kirchenmänner seiner Zeit
Das „Reich Gottes im Kleinen“, das sich Wichern und seine Frau Amanda erträumt hatten, wächst, gedeiht und erfordert neue Erzieher. In einer eigenen „Brüderanstalt“ bildet Wichern von 1839 an die Erziehungsgehilfen aus. In ganz Deutschland spricht sich das erfolgreiche Wirken des Hamburger Theologen herum. Wichern wird zu einem der bekanntesten Kirchenmänner seiner Zeit.
In ihm reift eine neue, noch größere Vision: Die Kirche müsse sich dringend um die Arbeiter kümmern, die ihr den Rücken zuwenden oder gar den Parolen der „gottlosen Kommunisten“ folgen. Dem gelte es, Einhalt zu gebieten. Kirche dürfe nicht nur „Heiden“ in fernen Ländern missionieren, sondern müsse auch im eigenen Land die Menschen wieder zum Glauben bringen. Straßenmission und Diakonie, Bildungsarbeit und Rettungshäuser, alles organisiert in Form freier Vereine, könnten die Kirchenfernen zurückholen. Hoffnungsvolle Aktivitäten, die unter dem Schlagwort „Innere Mission“ zusammengefasst werden.
Gründung des „Centralausschuss der Inneren Mission“
1848 erhält Wichern in Wittenberg Gelegenheit, sein Anliegen vor den versammelten Vertretern der deutschen Landeskirchen zu entfalten. In einer mitreißenden Stegreif-Rede überzeugt er sie, ein Jahr darauf gründet sich der „Centralausschuss der Inneren Mission“. Ein Datum, das als Geburtsstunde der modernen Diakonie gilt.
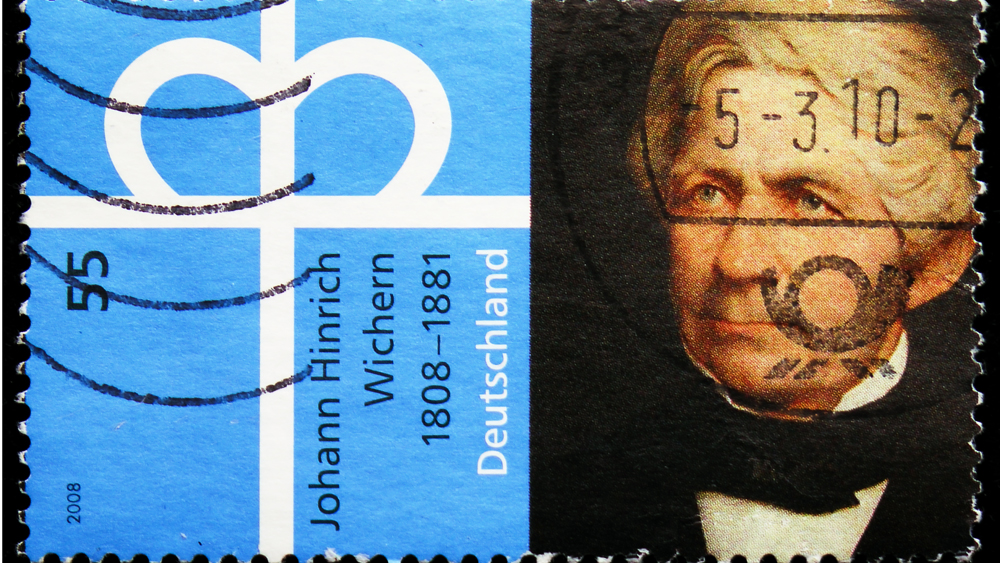
Durch alle Regionen Deutschlands reist Wichern und wirbt für seine Ideen. Allenorten gründen sich Vereine der Inneren Mission. Vorbehalte äußern nur einige lutherische Kirchenmänner, die in der preußisch-unierten Herkunft Wicherns Zersetzendes wittern. Besonders in Bayern, das Wichern 1849 bereist, trifft der preußische Protestant auf Widerstand. Dennoch: Die Innere Mission ist nicht mehr aufzuhalten.
Wicherns Erfolg spricht sich bis zum preußischen Königshof herum. Der fromme evangelische Monarch Friedrich Wilhelm IV. lässt sich von Wichern begeistern. Besonders bei einer Reform des Gefängniswesen soll ihm der fromme Sozialreformer zur Seite stehen. Das königliche Ansinnen und die neue Aufgabe fordern Wicherns Ehrgeiz und Eitelkeit heraus. Als Beauftragter der preußischen Regierung widmet er sich von 1851 an der Reform der Strafanstalten. Das Gefängnis Berlin-Moabit soll zum Vorzeigeprojekt werden. 1856 werden alle dortigen Aufseher durch Brüder des Rauhen Hauses ausgetauscht.
Einzelhaft als Gelegenheit zur Besinnung
Wichern setzt das Modell der strengen Einzelhaft durch. Die Isolation soll jedoch keine Strafmaßnahme sein, sondern den Gefangenen Gelegenheit zur Muße und Besinnung geben. Um die große Nachfrage nach Brüdern erfüllen zu können, gründet Wichern 1858 das Berliner „Johannesstift“.

Als der König abdankt, leidet auch Wicherns Ansehen. Kritiker werfen ihm Zwangsmissionierung vor. Die Reformen werden gestoppt. Wichern ist am Ende seiner Kräfte und zieht sich nach Hamburg zurück. 1866 erleidet er einen Schlaganfall, weitere folgen. Seine letzten Jahre verbringt er im Rauhen Haus. Am 7. April 1881, nach sieben Jahren schwerem Siechtum, stirbt er.
