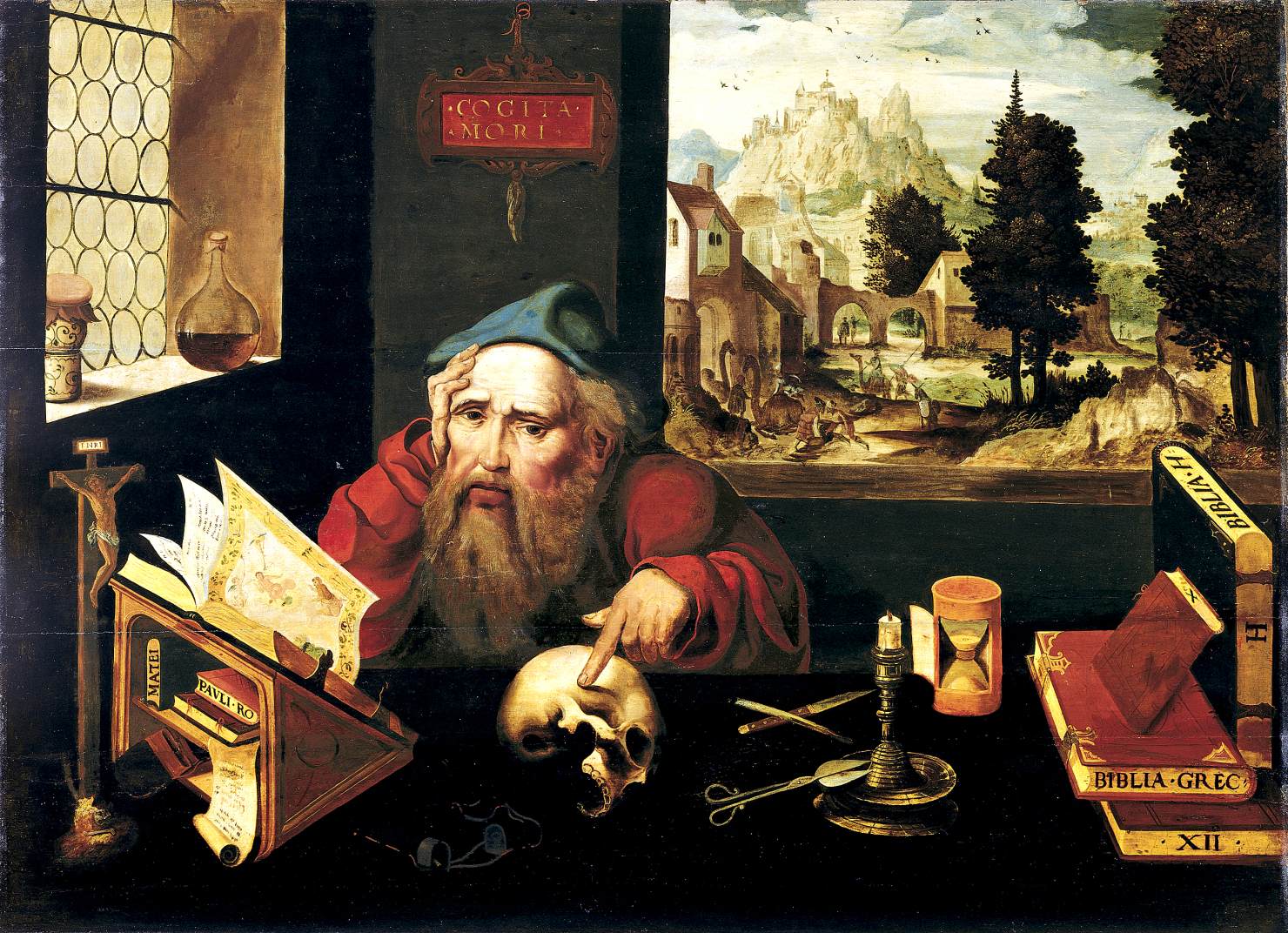Wer Reformation sagt, denkt Bibelübersetzung mit. Das, was Martin Luther erstmals vorlegte – eine Übersetzung aus den hebräischen und griechischen Originaltexten des Alten und Neuen Testaments –, beschäftigt die theologische und sprachwissenschaftliche Forschung bis heute.
Martin Luthers Übersetzungen schufen allen Gläubigen die Möglichkeit, ihre heiligen Schriften in der eigenen Sprache kennenzulernen und einen persönlichen Zugang zu den Grundlagen ihres Glaubens zu erhalten. Zudem stieß er eine Entwicklung der deutschen Sprache an, die zuvor ohne Beispiel war: Er erfand neue Wörter und Sprachbilder und trug dazu bei, dass sich im deutschsprachigen Raum ein einheitlicher Wortschatz etablierte.
Luthers Übersetzungsleistung war geprägt von seiner unermüdlichen Suche nach einem Wort oder Ausdruck, die den ursprünglichen Begriff in seinem Bedeutungszusammenhang so genau wie möglich wiedergaben – und dabei auch noch so allgemein verständlich waren, dass Menschen aus allen Schichten und Bildungsgraden es erfassen konnten. Gleichzeitig setzte er klare theologische Akzente, indem er seine Rechtfertigungslehre mit dem häufigen Gebrauch von Wörtern wie Gnade, Glaube oder Buße hervorhob.
Der Reformator hielt sich nah an die griechischen und hebräischen Vorlagen, übertrug aber Satzbau und Grammatik in die deutschen Sprachgewohnheiten. Zu dieser Übersetzungstechnik gehört auch, dass bestimmte Wörter aus der Ausgangssprache nicht immer mit demselben Wort in der Zielsprache wiedergegeben werden. Vielmehr wird, je nach Zusammenhang – oder je nach theologischer Vorentscheidung –, aus einem Wortfeld ausgewählt. Das wiederum prägt dann die inhaltliche Ausrichtung der Übersetzung.
Eine neues Übersetzungsprojekt will solche inhaltlichen Vorentscheidungen so weit wie möglich vermeiden und sich allein auf die sprachwissenschaftlich begründete Übersetzung konzentrieren. Die beiden Wissenschaftler, die sich dieser Aufgabe verschrieben haben, ergänzen sich dabei mit ihrem Spezialwissen: Stefan Alkier ist Professor für Neues Testament und Geschichte der Alten Kirche an der Universität Frankfurt a.M.; ebenfalls dort lehrt Thomas Paulsen als Gräzist und damit als Experte für das antike Griechisch.
Ihr „Frankfurter Neues Testament“ sieht die biblischen Schriften in erster Linie als Literatur im griechischen Sprachraum des 1. und 2. Jahrhunderts nach Christus. Zu dieser Zeit sprach man im östlichen Mittelmeerraum die sogenannte Koine – eine von allen Sprachfamilien verstandene Verkehrssprache, die vor allem auf dem in Athen gesprochenen Griechisch beruhte.
Die Koine, in der die Schriften den Neuen Testaments verfasst worden waren, galt lange Zeit als besonders simpel. Die Forschung ging davon aus, dass die Autoren wohl keine griechischen Muttersprachler waren, sondern aus dem hebräisch-aramäischen Sprachraum stammten und quasi eine eigene, vereinfachte „Bibel-Koine“ entwickelt hätten. Daraus leitete man eine Reihe von Sonderbedeutungen für die im Neuen Testament verwendeten Wörter ab.
Alkier und Paulsen stellen dagegen die These auf, dass sich die neutestamentlichen Verfasser völlig im Rahmen der üblichen Koine bewegen. Die Schlichtheit ihrer Sprache sehen die beiden Wissenschaftler als bewusste Entscheidung, um Menschen aller Bildungsschichten mit dem Evangelium zu erreichen. Zudem seien alle Begriffe, die Bibelautoren benutzen, der allgemein gebräuchlichen Sprache ihrer Zeit entnommen. Statt nach Sonderbedeutungen suchen Alkier und Paulsen daher bei ihrer Übertragung nach Begriffen, die sich im antiken Sprachgebrauch auch außerhalb der Bibel finden. Ähnlich wie Luther drehen und wenden sie dabei jedes einzelne Wort.
Prominentes Beispiel ist der Begriff „Buße“, griechisch „metanoia“. Er hat in der griechischen Alltagssprache keinen Beiklang von Wiedergutmachung durch Reue und Strafe, sondern meint „Umdenken“ im Sinne von Besserung und Neuorientierung. Ein weiteres Beispiel ist „baptisma“, was traditionell mit „Taufe“ übersetzt wird. Damit ist bereits eine Vorstellung des christlichen Rituals verbunden, das sich jedoch erst nach Jesu Tod und Auferstehung entwickelt hat. Alkier und Paulsen korrigieren daher in „Tauchbad“, was dem allgemein üblichen Gebrauch des Wortes entspricht: das „Eintauchen von etwas in etwas anderes“.
Gewöhnungsbedürftig ist, dass die beiden Übersetzer sich auch im Satzbau möglichst nah an das griechische Original anlehnen. Ein Satz aus dem Beginn das Markus-Evangeliums mag das verdeutlichen: „Es geschah: Johannes, Tauchbad spendend in der Einöde und verkündigend ein Tauchbad des Umdenkens zur Ablassung von Verfehlungen“ – das liest sich zunächst mühsam. Aber es lohnt sich – das „Frankfurter Neue Testament“ ist reich an Aha-Momenten und Entdeckungen, die hinausführen über den (allzu) gewohnten Wortschatz bisheriger Bibelübersetzungen und damit neue Zugänge zum Evangelium ermöglichen.
• Stefan Alkier/Thomas Paulsen (Herausgeber): Frankfurter Neues Testament.
Verlag Brill Schöningh. Band 1: Die Apokalypse des Johannes, 137 Seiten, 39,90 Euro, ISBN 978-3-506-70281-4; Band 2: Die Evangelien nach Markus und Matthäus, 301 Seiten, 56 Euro, ISBN: 978-3-657-70435-4.